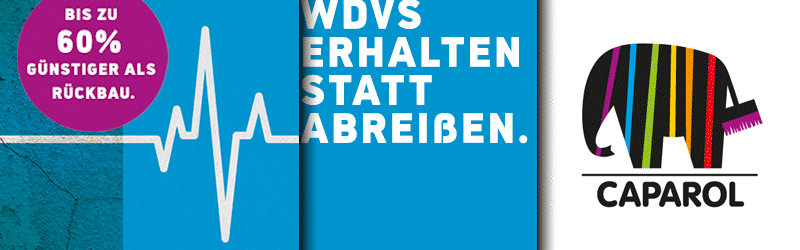Die Folgen des Klimawandels zeigen es immer deutlicher: Die Stadt der Zukunft braucht eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung. Dabei reicht es nicht, dass sich einzelne Bauherren gegen eine fossile Heizlösung entscheiden oder dass in Bestandsobjekten auf eine Wärmepumpe umgestellt wird. Einen viel größeren Hebel bietet die Konzeption ganzer Quartiere oder Siedlungen, in denen erneuerbare Energie zum Einsatz kommt. Mit Hilfe einer klimafreundlichen Stadtentwicklung lässt sich die Nutzung von erneuerbaren Energien ausbauen, wodurch CO2-Emissionen deutlich gesenkt werden können.
Dazu trägt auch die kommunale Wärmeplanung bei, bei der Städte und Gemeinden ein Konzept für die zukünftige Wärmeversorgung von privaten Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen erarbeiten. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme bei Erzeugung und Verteilung nutzen lassen. Das Wärmeplanungsgesetz regelt, bis wann die Wärmepläne erstellt sein müssen. Für alle Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner:innen ist am 30.06.2026 Stichtag. Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen haben bis zum 30.06.2028 Zeit. Zudem legt das Wärmeplanungsgesetz fest, dass alle Wärmenetze bis 2040 einen Anteil von 80 % erneuerbarer Energien aufweisen müssen. Als umweltschonender Wärmeerzeuger und entscheidender Baustein für eine ressourcenschonende Wärmeversorgung kommt hier vor allem die Wärmepumpe ins Spiel.
„Mit Wärmepumpen lässt sich die Energiewende voranbringen, und mit Hilfe von Großwärmepumpen geschieht dies in Quartieren eben in großem Stil“, bestätigt Michael Lechte, Product Marketing Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.
Doch was zeichnet eine Großwärmepumpe genau aus? Was unterscheidet sie von einer Wärmepumpe, wie sie zum Beispiel in Einfamilienhäusern zum Einsatz kommt? Zunächst einmal nicht viel: Technisch gesehen ist die Funktionsweise dieselbe wie bei kleineren Wärmepumpen. In den Varianten Luft/Wasser und Sole/Wasser oder Wasser/Wasser erhältlich, sind sie mit Heizleistungen ab 100 kW bis in den Megawatt-Bereich jedoch vor allem für größere Projekte in einem anspruchsvollen Umfeld konzipiert. Was sie darüber hinaus auszeichnet, ist die große Auswahl an Optionen und Konfigurationen, wodurch in punkto Planung und Auslegung der Systeme ein hoher Grad an Individualisierung möglich ist. Nicht zuletzt trägt dazu auch die Vielfalt der möglichen Wärmequellen bei, die eine Großwärmepumpe nutzen kann.
Neben der Umgebungsluft gehören dazu auch See-, Fluss- und Meerwasser sowie Grund-, Brunnen- und Thermalwasser. Hinzu kommen die anthropogenen, also die vom Menschen gemachten Quellen, wie Abwasser sowie die Abwärme von industriellen Prozessen und Rechenzentren.
„Ganz gleich, ob bei einem Projekt oder Quartier Luft, Wasser, natürliche oder industrielle Wärmequellen in Frage kommen, dank unserer breiten Produktpalette können wir immer die jeweils optimale Systemlösung anbieten“, erklärt Lechte und verweist auf ein Projekt in Irland: das Tallaght District Heating, Irlands erstes kohlenstoffarmes Fernwärmenetz. Um Gewerbe- und Privatkunden mit kohlenstoffarmer Wärme zu versorgen, nutzt das System die reichlich vorhandene Abwärme eines nahegelegenen Rechenzentrums, die andernfalls verschwendet würde. Das System ist 1,5 km lang und hat zunächst 32.800 m2 öffentliche Gebäude beheizt. Ebenfalls gehört die Versorgung von 133 Mietwohnungen über dieses Netz zum Projekt – ebenso wie weitere öffentliche Gebäude, die in den Folgejahren dazu kommen sollen.
Im Normalbetrieb wird der Wärmebedarf vollständig durch die Wärme des Rechenzentrums gedeckt, während der Spitzenbedarf im Winter durch spezielle Wärmepumpen und Wärmepumpenmodule gedeckt wird. Die Lösung mit 3.000 kW zusätzlicher Heizleistung basiert auf zwei FOCS2-W-Geräten aus dem Hause Mitsubishi Electric. Dank der Verwendung des HFO-Kältemittels R1234ze mit niedrigem Treibhauspotenzial kommt hiermit ein zuverlässiges, effizientes und vollständig nachhaltiges System zum Einsatz.
Noch eine Spur umweltverträglicher arbeiten Großwärmepumpen in einem Energiemix mit einer Photovoltaikanlage. So geschehen in einem Geschosswohnungsbau-Projekt in Künzelsau. Das in modularer Holzbauweise errichtete Quartier umfasst 80 barrierefreie Wohnungen in vier Wohnblocks. Um die Wärmeversorgung sicherzustellen, wurden vier Luft/Wasser- Großwärmepumpen vom Typ MEHP-iS-G07 des Ratinger Herstellers installiert, die als Energiequelle die Außenluft nutzen. Mit ihrer regenerativen Stromproduktion unterstützen die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der vier Wohnblocks zu einem großen Teil den Betrieb der Wärmepumpen. Die modulare Struktur der Geräte gewährleistet eine optimale Anpassung an den jeweiligen Leistungsbedarf, so dass sich mit diesen Systemen auch der Einsatz in Nahwärmenetzen realisieren lässt.